Alexander Bieseke
Frankreich will soziale Netzwerke für unter 15‑Jährige verbieten. Das dänische Parlament will ein Mindestalter von 15 Jahren für die Nutzung sozialer Medien einführen.Kaum ein politischer Vorstoß der letzten Jahre bündelt so viele Grundsatzfragen auf einmal: Schutz von Kindern versus Freiheit, staatliche Verantwortung versus elterliche, nationale Alleingänge versus europäische Lösungen. Und mittendrin die grundsätzliche Skepsis gegenüber staatlicher Macht, wie sie etwa Henryk M. Broder formuliert – die Warnung vor einer schleichenden „Aptokratie“, in der Wohlmeinende regeln, was andere denken, sagen oder sehen dürfen.
Die Debatte verdient mehr als reflexhafte Empörung. Sie verlangt Nüchternheit.
Warum ein Social‑Media‑Verbot für Kinder gute Gründe hat
Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie verfügen weder über die emotionale Reife noch über die kognitive Selbstkontrolle, die nötig ist, um algorithmisch optimierte Aufmerksamkeitsmaschinen souverän zu nutzen. Soziale Netzwerke sind keine neutralen Kommunikationsräume. Sie sind Geschäftsmodelle, die auf Dauerbindung, Vergleichsdruck und emotionaler Zuspitzung beruhen.
Dass exzessive Nutzung mit Schlafmangel, Konzentrationsproblemen, Angststörungen und depressiven Symptomen korreliert, ist inzwischen gut belegt. Der Staat greift hier nicht in ein abstraktes Freiheitsrecht ein, sondern reagiert auf eine reale Schutzlücke. Wir akzeptieren Altersgrenzen bei Alkohol, Tabak, Glücksspiel oder Autofahren – nicht aus Bevormundung, sondern aus Fürsorge.
Ein Verbot unter 15 ist deshalb kein Ausdruck von Misstrauen gegenüber Jugendlichen, sondern von Realismus gegenüber Plattformen.
Eltern allein reichen nicht mehr
Gern wird argumentiert, Medienerziehung sei ausschließlich Sache der Eltern. Das ist richtig – und zugleich unzureichend. Denn Eltern stehen heute globalen Konzernen gegenüber, deren Ressourcen, Datenmacht und psychologische Optimierung jede individuelle Erziehung unterlaufen können. Wer die Verantwortung vollständig privatisiert, überfordert Familien systematisch.
Staatliche Regeln setzen hier einen Rahmen, der Eltern stärkt, statt sie zu entmündigen. Sie schaffen eine gemeinsame Leitplanke – nicht den perfekten Schutz, aber einen besseren Ausgangspunkt.
Warum eine EU‑weite Regelung sinnvoller wäre als nationale Alleingänge
Frankreichs Vorstoß ist mutig, aber unvollständig. Digitale Plattformen kennen keine Grenzen, nationale Gesetze dagegen sehr wohl. Ein Flickenteppich aus Altersregeln lädt zur Umgehung ein und schwächt die Durchsetzung.
Eine EU‑weite Regelung hätte drei entscheidende Vorteile:
1. Gleiches Recht im digitalen Binnenmarkt – Plattformen müssten einheitliche Standards umsetzen.
2. Mehr Durchsetzungsmacht – Europa als Markt ist groß genug, um Regeln durchzusetzen, ohne sofort erpressbar zu sein.
3. Weniger Willkür – gemeinsame Regeln reduzieren den Verdacht politischer Motive einzelner Regierungen.
Wenn Regulierung, dann bitte auf der Ebene, auf der digitale Macht tatsächlich existiert.
Broders Warnung: berechtigt – aber nicht zwingend zutreffend
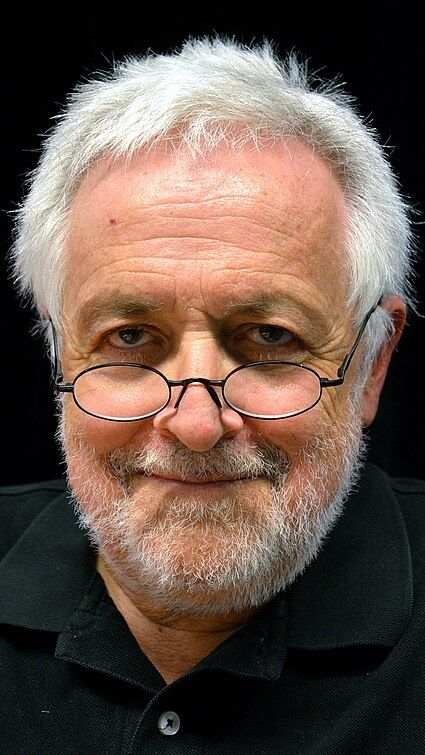
Henryk M. Broder warnt vor einer Entwicklung, in der der Staat zunehmend definiert, was akzeptable Meinung, akzeptable Medien und akzeptables Verhalten sind. Seine Kritik an Politikern wie Daniel Günther zielt auf einen empfindlichen Punkt: Wo der Staat beginnt, Medien zu delegitimieren oder zu „sortieren“, verlässt er den Boden liberaler Demokratie.
Diese Warnung ist wichtig. Aber sie darf nicht alles überstrahlen.
Ein Social‑Media‑Verbot für Kinder ist keine Meinungsregulierung. Es entscheidet nicht über Inhalte, Wahrheiten oder politische Positionen. Es reguliert Zugang – altersbezogen und zeitlich begrenzt. Wer das automatisch mit Presse‑ oder Meinungsfreiheit gleichsetzt, verwischt entscheidende Unterschiede.
Der Maßstab muss klar bleiben: Schützt eine Regel Schwächere – oder diszipliniert sie Abweichler? Im ersten Fall ist sie legitim, im zweiten gefährlich.
Freiheit braucht manchmal Regeln
Liberale Gesellschaften leben vom freien Wort. Aber sie leben auch davon, dass Freiheit nicht zur Überforderung wird. Kinder vor systematischer digitaler Überwältigung zu schützen, ist kein Schritt in Richtung Autoritarismus – solange die Maßnahme klar begrenzt, transparent begründet und demokratisch kontrolliert ist.
Die eigentliche Gefahr liegt nicht darin, dass der Staat Regeln erlässt. Sie liegt darin, wenn er verlernt, sich selbst zu begrenzen.
Frankreichs und Dänemarks Vorstoß sollte deshalb nicht reflexhaft verteufelt, sondern europäisch weitergedacht werden: als gezielte, überprüfbare Schutzmaßnahme – und nicht als Blaupause für Meinungskontrolle.
Der Blick nach Bad Driburg: Wenn abstrakte Debatten konkret werden
Die Debatte wirkt abstrakt – bis sie vor der eigenen Haustür ankommt. Am Dienstag kam es auf dem Heimweg von der Gesamtschule in Bad Driburg zu einem Vorfall zwischen zwei Neuntklässlern. Ein 16-Jähriger zog dabei mutmaßlich eine Schreckschusspistole und hielt sie seinem 15-iährigen Mitschüler ins Gesicht. Die Polizei ermittelt, psychologische Betreuung wurde organisiert.
Es geht nicht um Schuldzuweisungen an Schule oder Eltern. Es geht um das Umfeld, in dem Jugendliche heute aufwachsen: digitale Dauerreizung, Provokation,
Grenzverschiebung. Soziale Netzwerke belohnen Aufmerksamkeit, nicht Verantwortung. Gewalt wird dort nicht erfunden. aber normalisiert. Der Fall zeigt, wie schmal der Grat zwischen Spiel, Drohung und realer Gefahr geworden ist. Wer vor diesem Hintergrund Altersgrenzen für soziale Netzwerke diskutiert, betreibt keine Symbolpolitik, sondern reagiert auf eine Realität, die längst offline angekommen ist.
Nicht jeder Brandmelder ist ein Brandstifter.

