Ethische Überlegungen am Beispiel des tragischen Falls in Bad Driburg
Alexander Bieseke
Bad Driburg. Der Einsatz von GPS-Trackern bei Seniorinnen und Senioren wirft wichtige ethische Fragen auf. Zentral ist die Wahrung der Selbstbestimmung: Eine Ortung darf nur mit freiwilliger Zustimmung erfolgen. Ist die betroffene Person nicht mehr geschäftsfähig, muss ein rechtlicher Vertreter – etwa im Rahmen einer Vorsorgevollmacht – eine Entscheidung im Sinne der Person treffen. Entscheidend ist, dass der Einsatz zweckgebunden bleibt: Bei Menschen mit Demenz dient ein GPS-Tracker nicht der Überwachung, sondern dem Schutz und der Sicherheit. Er kann Betroffenen mehr Freiheit geben, weil die Angst, sich zu verirren, verringert wird.
Die Maßnahme muss stets verhältnismäßig sein. Der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht ist nur dann vertretbar, wenn er freiwillig erfolgt oder im Interesse der Person notwendig ist, um Gefahren wie Verletzungen oder sogar den Tod zu verhindern. Ohne Zustimmung stellt die Ortung hingegen einen massiven Eingriff in die Handlungsfreiheit dar und ist ethisch problematisch.
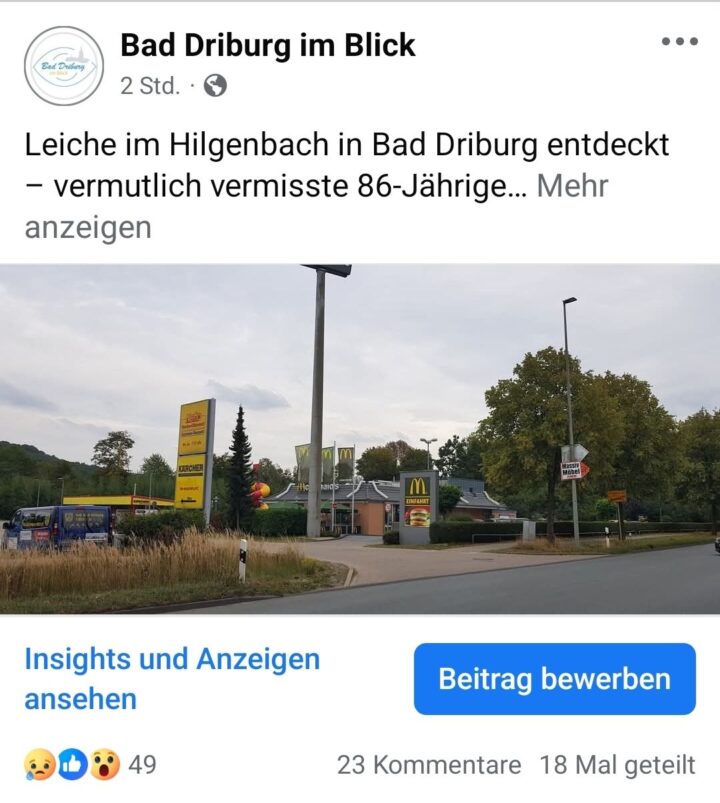
Der tragische Fall der in Bad Driburg aufgefundenen 86-jährigen Frau verdeutlicht die Relevanz dieser Fragen. Die Seniorin war zwei Wochen lang vermisst, bevor sie tot geborgen wurde. Ein GPS-Tracker hätte wahrscheinlich geholfen, sie schneller zu finden und ihr Leben zu retten. Hier zeigt sich der Spannungsbogen zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung: Schutz vor Gefahr steht gegen das Recht auf Autonomie. Der Fall macht deutlich, dass ethische Abwägungen beim Einsatz technischer Hilfsmittel nicht abstrakt bleiben dürfen. Nur verantwortungsbewusster Einsatz kann Sicherheit und Würde gleichermaßen gewährleisten.

